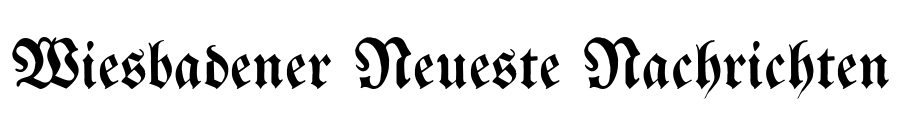Die Einnahmen der Städte und Gemeinden durch die Grundsteuer verzeichneten bereits vor der umstrittenen Reform im Jahr 2025 einen anhaltenden Anstieg. Dieser Trend wirft Fragen auf hinsichtlich der zugesicherten Aufkommensneutralität der Reform und der gerechten Verteilung der Steuerlast.
Die Entwicklung der Hebesätze, die vor der Reform in der Verantwortung der Kommunen lag, spielt hierbei eine maßgebliche Rolle. Die Tatsache, dass Hebesätze variabel sind und zu unterschiedlichen Steuerbelastungen führen können, verdeutlicht die Vielfalt der Auswirkungen der Grundsteuerreform.
Es lässt sich beobachten, dass einige Gemeinden auf die Neuregelungen reagierten, indem sie ihre Hebesätze senkten, während andere Gemeinden eine Erhöhung vornahmen. Es ist zu beachten, dass Widersprüche gegen Grundsteuerbescheide aufgrund angehobener Hebesätze in der Regel wenig Erfolg versprechen.
Die Schlussfolgerung liegt nahe, dass trotz angestrebter Aufkommensneutralität durch die Reform, Ungleichheiten und verstärkte Lasten für bestimmte Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer nicht ausgeschlossen sind. Die Gestaltung der Hebesätze und die Bewertung der Grundstücke sind zentrale Faktoren für die künftige Steuerbelastung der Bürgerinnen und Bürger.